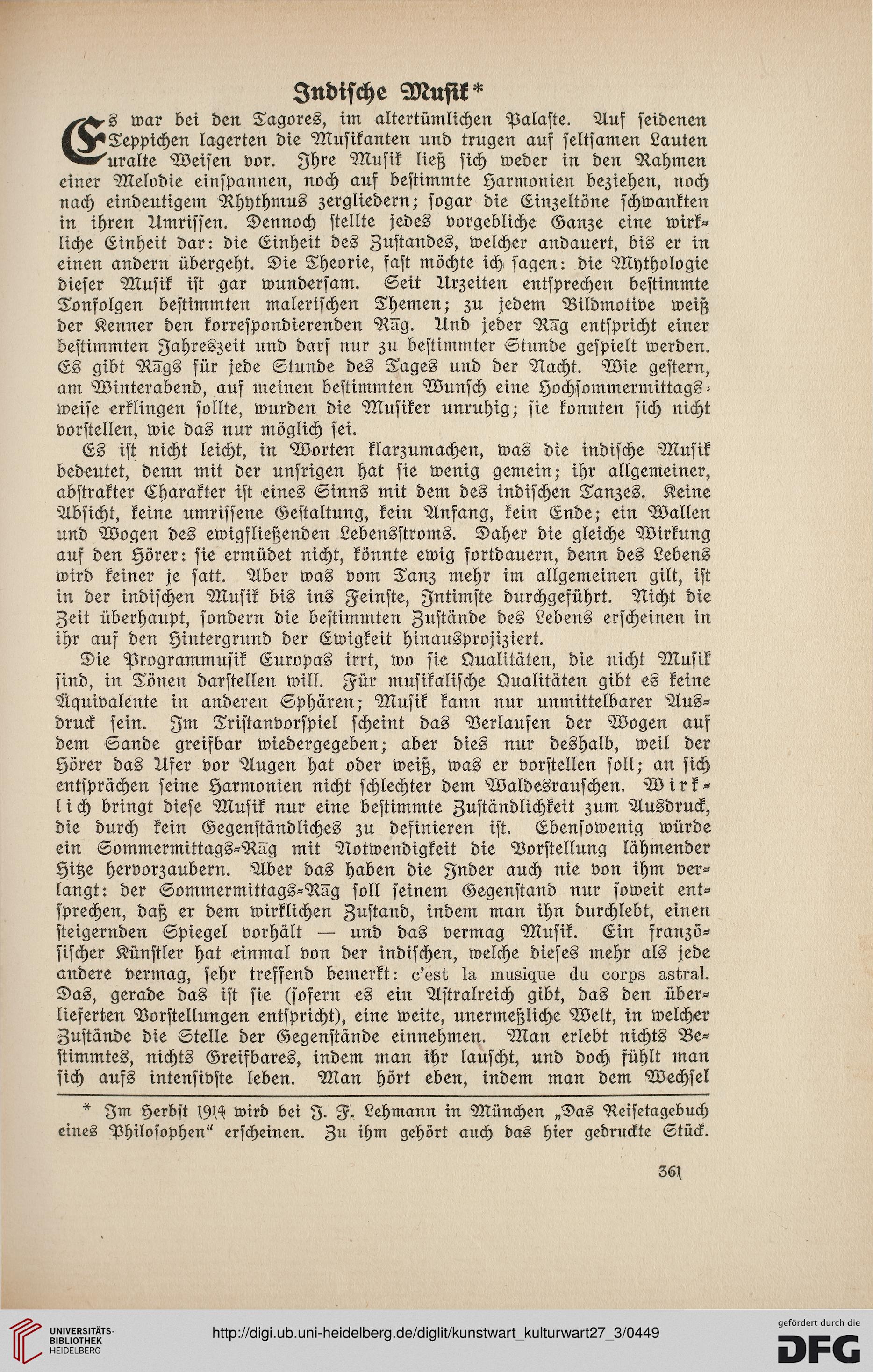Zndische Musik*
war bei den Tagores, im altertümlichen Palaste. Auf seidenen
A^^Teppichen lagerten die Musikanten und trugen auf seltsamen Lauten
^»^uralte Weisen vor. Ihre Musik ließ sich weder in den Rahmen
einer Melodie einspannen, noch auf bestimmte Harmonien beziehen, noch
nach eindeutigem Rhythmus zergliedern; sogar die (Linzeltöne schwankten
in ihren Rmrissen. Dennoch stellte jedes vorgebliche Ganze eine wirk»
liche Einheit dar: die Einheit des Zustandes, welcher andauert, bis er in
einen andern übergeht. Die Theorie, fast möchte ich sagen: die Mythologie
dieser Musik ist gar wundersam. Seit Rrzeiten entsprechen bestimmte
Tonfolgen bestimmten malerischen Themen; zu jedem Bildmotive weiß
der Kenner den korrespondierenden Räg. Und jeder Rüg entspricht einer
bestimmten Iahreszeit und darf nur zu bestimmter Stunde gespielt werden.
Es gibt Rügs für jede Stunde des Tages und der Nacht. Wie gestern,
am Winterabend, auf meinen bestimmten Wunsch eine tzochsommermittags»
weise erklingen sollte, wurden die Musiker unruhig; sie konnten sich nicht
vorstellen, wie das nur möglich sei.
(Ls ist nicht leicht, in Worten klarzumachen, was die indische Musik
bedeutet, denn mit der unfrigen hat sie wenig gemein; ihr allgemeiner,
abstrakter Charakter ist eines Sinns mit dem des indischen Tanzes. Keine
Absicht, keine umrissene Gestaltung, kein Anfang, kein Ende; ein Wallen
und Wogen des ewigfließenden Lebensstroms. Daher die gleiche Wirkung
auf den tzörer: sie ermüdet nicht, könnte ewig fortdauern, denn des Lebens
wird keiner je satt. Aber was vom Tanz mehr im allgemeinen gilt, ist
in der indischen Musik bis ins Feinste, Intimste durchgeführt. Richt die
Zeit überhaupt, sondern die bestimmten Zustände des Lebens erscheinen in
ihr auf den tzintergrund der Lwigkeit hinausprojiziert.
Die Programmusik Europas irrt, wo sie Qualitäten, die nicht Musik
sind, in Tönen darstellen will. Für musikalische Qualitäten gibt es keine
Aquivalente in anderen Sphären; Musik kann nur unmittelbarer Aus--
druck sein. Im Tristanvorspiel scheint das Verlaufen der Wogen auf
dem Sande greifbar wiedergegeben; aber dies nur deshalb, weil der
tzörer das Afer vor Augen hat oder weiß, was er vorstellen soll; an sich
entsprächen seine tzarmonien nicht schlechter dem Waldesrauschen. Wirk -
lich bringt diese Musik nur eine bestimmte Zuständlichkeit zum Ausdruck,
die durch kein Gegenständliches zu definieren ist. Ebensowenig würde
ein Sommermittags-Räg mit Rotwendigkeit die Vorstellung lähmender
tzitze Hervorzaubern. Aber das haben die Inder auch nie von ihm ver-
langt: der Sommermittags-Räg soll seinem Gegenstand nur soweit ent-
sprechen, daß er dem wirklichen Zustand, indem man ihn durchlebt, einen
steigernden Spiegel vorhält — und das vermag Musik. Ein sranzö-
sischer Künstler hat ernmal von der indischen, welche dieses mehr als jede
andere vermag, sehr treffend bemerkt: 1a musigns äu eorps astral.
Das, gerade das ist sie (sofern es ein Astralreich gibt, das den über-
lieferten Vorstellungen entspricht), eine weite, unermeßliche Welt, in welcher
Zustände die Stelle der Gegenstände einnehmen. Man erlebt nichts Be-
stimmtes, nichts Greifbares, indem man ihr lauscht, und doch fühlt man
sich aufs intensivste leben. Man hört eben, indem man dem Wechsel
^ Im tzerbst 191^ wird bei I. F. Lehmann in München „Das Reisetagebuch
eines Philosophen" erscheinen. Zu ihm gehört auch das hier gedruckte Stück.
war bei den Tagores, im altertümlichen Palaste. Auf seidenen
A^^Teppichen lagerten die Musikanten und trugen auf seltsamen Lauten
^»^uralte Weisen vor. Ihre Musik ließ sich weder in den Rahmen
einer Melodie einspannen, noch auf bestimmte Harmonien beziehen, noch
nach eindeutigem Rhythmus zergliedern; sogar die (Linzeltöne schwankten
in ihren Rmrissen. Dennoch stellte jedes vorgebliche Ganze eine wirk»
liche Einheit dar: die Einheit des Zustandes, welcher andauert, bis er in
einen andern übergeht. Die Theorie, fast möchte ich sagen: die Mythologie
dieser Musik ist gar wundersam. Seit Rrzeiten entsprechen bestimmte
Tonfolgen bestimmten malerischen Themen; zu jedem Bildmotive weiß
der Kenner den korrespondierenden Räg. Und jeder Rüg entspricht einer
bestimmten Iahreszeit und darf nur zu bestimmter Stunde gespielt werden.
Es gibt Rügs für jede Stunde des Tages und der Nacht. Wie gestern,
am Winterabend, auf meinen bestimmten Wunsch eine tzochsommermittags»
weise erklingen sollte, wurden die Musiker unruhig; sie konnten sich nicht
vorstellen, wie das nur möglich sei.
(Ls ist nicht leicht, in Worten klarzumachen, was die indische Musik
bedeutet, denn mit der unfrigen hat sie wenig gemein; ihr allgemeiner,
abstrakter Charakter ist eines Sinns mit dem des indischen Tanzes. Keine
Absicht, keine umrissene Gestaltung, kein Anfang, kein Ende; ein Wallen
und Wogen des ewigfließenden Lebensstroms. Daher die gleiche Wirkung
auf den tzörer: sie ermüdet nicht, könnte ewig fortdauern, denn des Lebens
wird keiner je satt. Aber was vom Tanz mehr im allgemeinen gilt, ist
in der indischen Musik bis ins Feinste, Intimste durchgeführt. Richt die
Zeit überhaupt, sondern die bestimmten Zustände des Lebens erscheinen in
ihr auf den tzintergrund der Lwigkeit hinausprojiziert.
Die Programmusik Europas irrt, wo sie Qualitäten, die nicht Musik
sind, in Tönen darstellen will. Für musikalische Qualitäten gibt es keine
Aquivalente in anderen Sphären; Musik kann nur unmittelbarer Aus--
druck sein. Im Tristanvorspiel scheint das Verlaufen der Wogen auf
dem Sande greifbar wiedergegeben; aber dies nur deshalb, weil der
tzörer das Afer vor Augen hat oder weiß, was er vorstellen soll; an sich
entsprächen seine tzarmonien nicht schlechter dem Waldesrauschen. Wirk -
lich bringt diese Musik nur eine bestimmte Zuständlichkeit zum Ausdruck,
die durch kein Gegenständliches zu definieren ist. Ebensowenig würde
ein Sommermittags-Räg mit Rotwendigkeit die Vorstellung lähmender
tzitze Hervorzaubern. Aber das haben die Inder auch nie von ihm ver-
langt: der Sommermittags-Räg soll seinem Gegenstand nur soweit ent-
sprechen, daß er dem wirklichen Zustand, indem man ihn durchlebt, einen
steigernden Spiegel vorhält — und das vermag Musik. Ein sranzö-
sischer Künstler hat ernmal von der indischen, welche dieses mehr als jede
andere vermag, sehr treffend bemerkt: 1a musigns äu eorps astral.
Das, gerade das ist sie (sofern es ein Astralreich gibt, das den über-
lieferten Vorstellungen entspricht), eine weite, unermeßliche Welt, in welcher
Zustände die Stelle der Gegenstände einnehmen. Man erlebt nichts Be-
stimmtes, nichts Greifbares, indem man ihr lauscht, und doch fühlt man
sich aufs intensivste leben. Man hört eben, indem man dem Wechsel
^ Im tzerbst 191^ wird bei I. F. Lehmann in München „Das Reisetagebuch
eines Philosophen" erscheinen. Zu ihm gehört auch das hier gedruckte Stück.